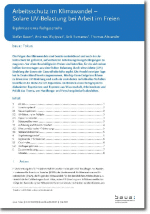Natürliche UV-Strahlung birgt ein erhöhtes Hautkrebsrisiko für Beschäftigte im Freien
UV-Strahlung von der Sonne wird seit 2012 von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) als Humankarzinogen der Gruppe I eingestuft und ist damit ähnlich krebserregend wie Asbest oder Tabak. Dies führt alleine in Deutschland zu jährlich mehr als 200.000 neuen Hautkrebserkrankungen. Beschäftigte, die im Freien arbeiten, sind einem erhöhten Hautkrebsrisiko ausgesetzt, welches jedoch durch einfache Maßnahmen effektiv verringert werden kann.
In zahlreichen Branchen, z. B. im Baugewerbe, in der Forst- und Landwirtschaft, im Zustelldienst, aber auch in der Lehre und Erziehung muss häufig im Freien gearbeitet werden. Der Arbeitsalltag dieser ca. 2–7 Millionen Beschäftigten (je nach Schätzung) findet ganz oder teilweise im Außenbereich statt, so dass ihre Jahresexposition gegenüber solarer UV-Strahlung im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich höher ist. Dabei führt eine Verdopplung der aufsummierten (kumulativen) UV-Dosis zu einem mehr als doppelt so hohen Risiko an einer Form des weißen Hautkrebses zu erkranken (exponentielle Dosis-Wirkungs-Beziehung).
Der Gesetzgeber trägt dieser Erkenntnis Rechnung und hat das Plattenepithelkarzinom sowie multiple aktinische Keratosen 2015 als Berufskrankheit BK 5103 in die Berufskrankheiten-Verordnung (BKV) aufgenommen. Darüber hinaus konkretisiert die Arbeitsmedizinische Regel AMR 13.3 die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) im Hinblick darauf, wann bei Tätigkeiten im Freien eine intensive Belastung durch natürliche UV-Strahlung und somit ein Angebotsvorsorgeanlass gegeben ist. Maßgeblich für den Schutz von Sicherheit und Gesundheit von Außenbeschäftigten sind das Arbeitsschutzgesetz (§4, 5, 11, 12 ArbSchG), die Arbeitsstättenverordnung (§3, 6, Anh. 5.1 ArbStättV) sowie insbesondere ihre Konkretisierung im Hinblick auf Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien durch die Arbeitsstättenregel ASR A5.1. Technische Regeln für Arbeitsstätten geben den Stand der Technik sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. Bei Einhaltung der ASR können Arbeitgeber davon ausgehen, die entsprechenden Anforderungen der ArbStättV zu erfüllen (Vermutungswirkung).
Unterstützung der Gefährdungsbeurteilung: der UV-Index
Arbeitgeber sind verpflichtet, Gefährdungen für Beschäftigte im Freien durch natürliche UV-Strahlung zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Als Beurteilungsmaßstab ist der zu erwartende lokale Höchstwert des UV-Index (UVI) während der Tätigkeit maßgeblich. Der UVI basiert auf der sonnenbrandwirksamen UV-Bestrahlungsstärke der Sonne und wird auf einer ganzzahligen Skala von 0 bis 11+ angegeben, entsprechend einer niedrigen (UVI bis 2), einer mittleren (UVI bis 5), einer hohen (UVI bis 7), einer sehr hohen (UVI bis 10) und einer extremen Gefährdung (ab UVI 11).

Die ASR A5.1 fordert ab einem UVI von 3 die Anwendung von Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor solarer UV-Strahlung, wobei mit steigendem UVI zunehmender Schutz notwendig wird. Dies kann durch eine sachgerechte Verknüpfung von technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen, siehe unten, erreicht werden. Ab einem UVI von 8 sind personenbezogene Maßnahmen zwingend erforderlich.
UV-Index-Jahreskalender
Basierend auf der Analyse von Daten der UV-Messstation in Dortmund für die Jahre 1998 bis 2018 wurde ein vereinfachter UVI-Jahreskalender entwickelt, in dem graphisch für jeden Monat der im langjährigen Mittel typsicherweise maximal erreichbare UVI-Wert abgebildet ist.

Beispielsweise wurde im genannten Analysezeitraum für den Januar in Dortmund noch kein UVI = 2 gemessen, wohingegen dies im Februar an einigen wenigen Tagen möglich ist. Im Juni kam es bisher durchschnittlich an weniger als einem Tag im Monat zu einem UVI = 8. Ein UVI = 9 wurde bis 2018 in Dortmund nicht registriert, ist aber an anderen Standorten in Deutschland und insbesondere in Höhenlagen möglich. Während im November noch an etwa 2 von 3 Tagen ein UVI = 1 vorliegt, ist dies im Dezember nur noch an insgesamt ca. 2 Tagen der Fall.
Der UVI-Jahreskalender bietet sich als orientierende Planungshilfe von Maßnahmen bei Außenbeschäftigung an, die zwischen März und Oktober umzusetzen sind. Allerdings sollten die im Jahreskalender genannten maximalen UVI als Orientierung angesehen werden, da je nach geographischer Lage und Bewölkungssituation ein abweichender UVI vorliegen kann. Auch durch sog. Niedrig-Ozon-Ereignisse in der Stratosphäre kann es im Frühjahr zu ungewöhnlich hohen UVI kommen. Insbesondere bei nach dem Winter höheren Temperaturen, damit verhaltensbedingt leichterer Bekleidung und verstärkter Außenaktivität, entsteht für die noch völlig ungebräunte Haut ein hohes Sonnenbrandrisiko. Hierfür gilt es Beschäftigte rechtzeitig, z. B. im Rahmen der Unterweisung, zu sensibilisieren.
Die folgende Abbildung gibt den aktuellen UV-Index am BAuA-Standort Dortmund wieder. UVI-Werte für ganz Deutschland werden u. a. auf der Seite des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) bekannt gegeben.

Maßnahmen
Grundsätzlich unterscheiden sich Empfehlungen zum Schutz vor natürlicher UV-Strahlung für Außenbeschäftigte nicht wesentlich von denen der Allgemeinbevölkerung. Technische und organisatorische Maßnahmen haben zwar Vorrang vor personenbezogenen Maßnahmen, eine sinnvolle Kombination bietet jedoch den effektivsten Schutz.
Technische Maßnahmen
sind alle Arten der Verschattung.
- Überdachungen, Einhausungen, Vordächer und Sonnensegel/Sonnenschirme für ständige Arbeitsplätze im Freien
- Sonnensegel/Sonnenschirme für mobile Arbeitsplätze, wobei regelmäßig die Ausrichtung zur Sonne geprüft werden muss
- seitliche Abschirmungen bei stark reflektierenden Oberflächen wie Metall- oder Glasfassaden und verschneiten Oberflächen
- vorhandene Unterstellmöglichkeiten durch Gebäude oder Bepflanzungen, wobei letztere häufig nur geringen UV-Schutz bieten
- allseits umschlossene Kabinen bei mobilen Arbeitsmitteln (geschlossene Fenster)
Es ist darauf zu achten, dass bei technischen Maßnahmen kein Hitzestau entsteht.
Organisatorische Maßnahmen
haben eine Minimierung der Aufenthaltszeit in der Sonne zum Ziel.
- in den Mittagsstunden (ca. 11 - 15 Uhr) den Aufenthalt in der Sonne vermeiden
- Tätigkeiten in beschattete Bereiche oder geschlossene Räume verlegen
- früherer Arbeitsbeginn oder späteres Arbeitsende (bei gleicher Arbeitsdauer)
- Pausenzeiten anpassen
- Tätigkeiten auf mehrere Beschäftigte verteilen
- bei hohem UV-Index Überstunden vermeiden
Darüber hinaus kommt der Unterweisung von Beschäftigten über mögliche Gefährdungen durch natürliche UV-Strahlung und damit verbundene Maßnahmen eine besondere Bedeutung zu.
Personenbezogene Maßnahmen
sind z. B.
- geeignete (langärmlige) körperbedeckende Bekleidung mit ausreichendem UV-Schutz, etwa durch dichtgewebte Stoffe,
- Kopfbedeckungen mit breiter Krempe, Nacken- und Ohrenschutz,
- Sonnenschutzmittel für Körperstellen, die nicht durch Textilien geschützt werden können, z. B. Gesicht, Handrücken, Hals (auf einen geeigneten Lichtschutzfaktor von mindestens 30, einschließlich UV-A-Filter, und eine sachgerechte, regelmäßige Anwendung ist zu achten) sowie
- UV-Schutzbrillen bzw. Sonnenbrillen mit an die jeweilige berufliche Tätigkeit angepasster Tönung.
Der Arbeitgeber hat in ausreichendem Umfang geeignete persönliche Schutzausrüstung, z. B UV-Schutzbrillen oder Sonnenschutzmittel, kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Die BAuA ist seit 1996 Mitglied im bundesweiten UV-Messnetz und seit 2013 Partner des UV-Schutz-Bündnisses